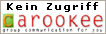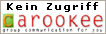 |
|
Multikulturelle Beziehungen
Hier treffen sich Menschen, die in multikulturellen Beziehungen leben
Lebt ihr auch in einer mulitkulturellen/binationalen Beziehung? Dann tauscht euch mit uns über eure Erfahrungen aus.
|
|
|
|
 |
|
Anfang
zurück
weiter
Ende
|
| Autor |
Beitrag |
OasisWeb
Administrator
Beiträge: 207
Ort: Köln

|
 Erstellt: 18.08.04, 12:03 Betreff: Die Mischung macht´s
drucken
weiterempfehlen Erstellt: 18.08.04, 12:03 Betreff: Die Mischung macht´s
drucken
weiterempfehlen
|
|
|
Eine politische Interessengemeinschaft, die ihr 30jähriges Bestehen feiern kann, vertritt offensichtlich Interessen, die auch nach 3 Jahrzehnten nicht ohne Lobby auskommen. Und sie ist - ebenso offensichtlich - eine Gemeinschaft, die willens und in der Lage ist, in ihrer Entwicklung mit den gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten.
Es gibt Interessen von Binationalen, die sind heute so aktuell wie vor dreißig Jahren. Und es gibt Probleme und Perspektiven, die sich in dieser Zeit erst entwickelt haben. Gleich geblieben ist das Prinzip unseres Verbandes, aus der Analyse der Interessen Aktivitäten zu entwickeln: ob politischer Protest, rechtliche Beratung, Begleitung in Konfliktsituationen, interkulturelle Projekte - neue Ideen in der iaf entstehen aus der guten Mischung von emotionaler Betroffenheit, reflektierter Erfahrung, Neugier und Pioniergeist.
Geschätzte zwei Millionen Binationale leben derzeit in Deutschland, jährlich kommen ca. 60 000 durch Eheschließungen dazu - dabei werden nur die von der Statistik erfasst, die in Deutschland heiraten. Bei der größten Gruppe unter ihnen ist ein Partner deutsch, doch wächst die Zahl der Menschen, bei denen kulturelle Sozialisation und Staatsangehörigkeit mehrdeutig werden: Eine/r ist hier aufgewachsen, der/die andere zugewandert, das gilt auch für Paare, die beide einen türkischen Ausweis haben. Die Russin mit deutschem Paß und der mittlerweile eingebürgerte Marokkaner, - die Statistik erfasst sie nicht als binationales Paar, ihre kulturellen Gewohnheiten können jedoch unterschiedlicher sein als die von zwei großstädtischen Bildungsbürgern verschiedener Nationalität.
Was verbindet diese Menschen, warum wenden sie sich als Ratsuchende an unseren Verband? Was eint diejenigen, die bei uns Mitglied werden?
Binationale Partnerschaften sind nicht nur Lebensentwürfe Einzelner, sondern auch Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. 1972 waren Auslandsreisen durchaus noch etwas Besonderes und das Wort "Globalisierung" kannten nur ein paar Experten; heute ist bundesweit jede sechste Eheschließung eine binationale, in Großstädten jede dritte. Früher erlebten binationale Paare Ausgrenzung, weil sie im öffentlichen Bewusstsein - und damit auch in den rechtlichen Regelungen - einfach nicht vorkamen; heute erfahren sie Diskriminierung - auch in den rechtlichen Regelungen - weil sie angeblich zu viele werden? Die Begründungen für Ungleichbehandlung wechseln, das Anliegen binationaler Familien und Paare bleibt: die Forderung nach rechtlicher Gleichstellung, die sich aus dem gemeinsamen Lebensmittelpunkt ableitet und unabhängig ist von der Staatsangehörigkeit.
"Politiker, oft Juristen, erzählen dir nicht selten Dinge, die so fürchterlich klug klingen und man versteht sie nicht" erzählt Rosi Wolf-Almanasreh aus den Anfangszeiten der iaf in diesem Heft. Verstehen wollen, was mit einem passiert; sich austauschen können mit Anderen, die ähnliches erleben; die Ohnmacht der Vereinzelung überwinden und aus den Erfahrungen Vieler eigene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln - aus diesen Bedürfnissen entstanden die regionalen iaf Gruppen, die heute in 30 Städten der Republik zu finden sind. So ist über die Jahre ein breites Netz entstanden, in dem persönliche Beratung, interkulturelle Themen und politische Lobbyvertretung die wichtigsten Verknüpfungen darstellen.
Grenzüberschreitende Liebesverhältnisse sind ein ganz persönliches Abenteuer, mit all den Glücksmomenten und Risikofaktoren, die intime Beziehungen so mit sich bringen. Emotionale Nähe macht verletzlich, aber auch erfinderisch. Die Konfrontation mit kulturell fremden Denk- und Verhaltensmustern ist in höchstem Maße irritierend, fasziniert aber auch durch die unmittelbare Erfahrung einer anderen Sicht auf die Welt. "Liebe kann Berge versetzen" sagt der Volksmund; binationale Paare entdecken für sich oft ganz neue Landschaften. In einer bikulturellen Beziehung ist man häufig zwischen den Extremen unterwegs, entdeckt ungeahnte Höhen und Abgründe, nicht zuletzt bei sich selbst. Der bewusste Umgang mit Unterschieden führt zu persönlichen Selbst - Erkenntnissen, die auch bei einem Scheitern der Beziehung das biographische Gepäck bereichern.
In krassem Gegensatz dazu steht der überwiegend kritische, vereinfachende Blick der Außenwelt. Binationale Beziehungen werden von der Gesellschaft nach wie vor in erster Linie als "Problempartnerschaften" gesehen - eine Haltung, die die Paare manchmal in die absurde Situation bringt, ihr Glück rechtfertigen zu sollen. Ob es um die Religion geht, Männer- und Frauenrollen, die Haltung der Verwandten oder die Erziehung der Kinder - grundsätzlich liegt hier erst mal ein Problem, das mal besser mal schlechter gelöst wird. Der kulturellen Differenz wird dabei ein Stellenwert gegeben, der die individuellen biographischen Dispositionen, den sozialen Status und das konkrete gesellschaftliche Umfeld wenig berücksichtigt - Lebensweltfaktoren also, die binationale und Migrantenfamilien mit deutschen Einheimischen teilen.
Allerdings haben binationale Paare durchaus Probleme, die deutsche nicht haben. Bei einer binationalen Liebe hängt der Himmel nicht nur voller Geigen, sondern ist gespickt mit Paragrafen. Am Anfang steht immer die Behörde, deren Entscheidungslogik oft schwer nachzuvollziehen ist. Zwischen dem grundgesetzlich verankerten Recht auf Schutz der Familie und der politisch gewollten Begrenzung von Zuwanderung finden sich binationale Paare in einem Dickicht von Vorschriften, Unterstellungen und Kontrollen wieder, die eine binationale Eheschließung nicht selten zu einem kostspieligen Parcoursritt durch Auslandsvertretungen, Ausländerbehörden und Oberlandesgerichten macht. 16 000 Beratungsanfragen pro Jahr zeigen die Dimension der Probleme - und das Wissen unserer Berater/innen. Eine Reaktion unseres Verbandes auf die wachsende Komplexität der Anfragen ist die ständige Qualifizierung und der organisierte Austausch der Berater/innen untereinander sowie Spezialisierungen wie z.B. das Projekt Leschiak zur Beratung gleichgeschlechtlicher binationaler Paare. In den östlichen Bundesländern, die nicht auf eine gewachsene Struktur von iaf Gruppen zurück blicken können, wird ein mobiles Beratungsangebot durchgeführt: in Kooperation mit örtlichen Organisationen und kommunalen Stellen kommt die Beraterin zu den Ratsuchenden. Auch wenn das für die Kollegin in Leipzig pro Jahr ca. 20 000 Fahrkilometer bedeutet.
Binationale Beziehungen endlich als gesellschaftliche Normalität anzuerkennen ist ein Interesse, das in den letzten Jahren verstärkt artikuliert wird. Und neben der rechtlichen Gleichstellung heißt das in erster Linie: Die Wahrnehmung von Differenz nicht auf Kultur zu reduzieren. Geschwister können in ihren Handlungen gegensätzlicher sein als Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die ein gemeinsamer Alltag verbindet. Die Differenz zwischen Männern und Frauen hat im Zusammenleben oft eine gewichtigere Bedeutung als die kulturelle Prägung. Der soziale Status baut höhere Barrieren auf als die jeweilige Staatsangehörigkeit. Inländer sind so unterschiedlich wie Ausländer, abhängig von ihrer Lebensphase: ob sie als Paar zusammen leben, eine Familie gründen oder als Single ihr Leben gestalten. Die konkrete Lebenssituation trennt oder verbindet, durch ihre Veränderung entstehen neue Abgrenzungen oder Bündnisse. Die Balance zu finden zwischen Zuwendung und Abwehr, zwischen Neugier und Rückzug, das Aushandeln unterschiedlicher Bedürfnisse und der Streit um die jeweiligen Aufgaben ist das "tägliche Brot" in allen Beziehungen. Auch den binationalen.
Der marokkanische Ehemann einer Deutschen hat es in der Konfliktberatung der iaf einmal so formuliert: "Wissen Sie, ich streite mich nicht mit meiner Frau, weil ich Marokkaner bin, sondern weil ich mit ihr verheiratet bin."
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Anerkennung als gesellschaftliche Normalität heißt auch, die individuellen wie kulturellen Ressourcen zu nutzen, die Zuwanderer der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Doch bevor man sie nutzt, muss man sie erst mal wahrnehmen. Binationale Familie erproben im Kleinen, womit sich die Gesellschaft im Großen so schwer tut: Möglichkeiten und Wege der Integration. Sie verbinden Normen und Werte aus unterschiedlichen Lebenswelten und entwickeln damit Verhaltensmöglichkeiten und Handlungsspielräume, die innovative Elemente für die Entwicklung unserer Gesellschaft enthalten. Interkulturelle Kompetenz -in binationalen Familien ist dies keine Zusatzqualifikation, sondern learning by doing, weil einem die Beziehung wichtig ist.
Und wir behalten dieses Wissen nicht für uns: iaf Mitglieder sind gefragte Referent/innen bei Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen. Aus einer Weiterbildungsmaßnahme für Mitarbeiter/innen öffentlicher Dienste entwickelte die iaf Berlin ein bundesweit viel beachtetes Modellprojekt zum Transfer interkultureller Kompetenz (TiK) in Ämter und öffentliche Beratungsstellen.
Der Reichtum kultureller Heterogenität, das Potential mehrsprachigen Aufwachsens, das Wissen um die Bedeutung früher antirassistischer Erziehung - es ist nicht zufällig, dass sich die meisten Projekte und Aktivitäten der regionalen iaf Gruppen mit dem interkulturellen Lernen beschäftigen: Bibliographien interkulturell wertvoller Bücher, Spiele und Materialien (iaf Bonn, Bremen, Tübingen); die jährliche Erstellung eines interkulturellen Kalenders (Bonn), angeleitete Kindergruppen mit moderierten Gesprächskreisen für die Eltern (Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover und München), Deutschförderung und Mehrsprachigkeit in Kindergärten (ein Projekt der Bundesgeschäftsstelle). Ähnliche Themen in jeweils eigenständiger Umsetzung zu bearbeiten - daraus entsteht Vernetzung und eine Struktur, die zu einem Qualitätsmerkmal von iaf Arbeit geworden ist.
Das Interesse von Binationalen, das sich hier artikuliert: die Ressourcen interkulturell lebender Familien kenntlich zu machen, sie anzuerkennen, zu fördern und in der Gesellschaft zu etablieren.
Grenzüberschreitend zu lieben und zu leben bedeutet auch, international zu handeln und zu kooperieren. Die Europäisierung nationaler Politik hat unser Verband schon früh zum Anlass genommen, Bündnispartner in anderen europäischen Ländern zu suchen. 1989 gründete sich die European Conference of binational/bicultural Relationships (ECB), der Organisationen aus sechs europäischen Ländern angehören. Auch hier dient Vernetzung dem Handeln: Im Jahr 2000 konzipierte die iaf in Zusammenarbeit mit drei Partnerorganisationen das von der EU-Kommission geförderte Projekt fabienne, mit dem eine bisher einmalige Erhebung über Diskriminierungserfahrungen binationaler Paare vorgelegt werden konnte.
Nach 30 Jahren schauen wir zurück und blicken nach vorn. Mit diesem Heft stellen wir einen Ausschnitt unserer Arbeit vor und Mitglieder erzählen, was sie mit der iaf verbinden. Aus dem rein ehrenamtlichen Engagement einer Handvoll Frauen ist ein professioneller Dienstleistungsverband geworden, in dem hauptamtliche Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich Aktive auf einem hohen Qualitätsniveau zusammen arbeiten. Ihnen ist in aller erster Linie dafür zu danken, dass die iaf zu dem geworden ist was sie heute repräsentiert. Auch andere haben dazu beigetragen, mit finanzieller und/oder fachlicher Unterstützung, die wir gar nicht alle aufführen können. Stellvertretend danken wir dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ohne dessen Förderung das bundesweite Beratungsnetz nicht hätte aufgebaut werden können. Für materielle wie ideelle Hilfe danken wir dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Deutschen Frauenrat, bei denen wir uns als Mitgliedsorganisation gut aufgehoben fühlen. Und stellvertretend für alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, danken wir der Journalistin Frau Annette Garbrecht in Hamburg, die aus einer Vielzahl von Papieren und Informationen den "Querschnitt unserer Arbeit" verfasst hat.
Qualifizierte Dienstleistung ist nicht umsonst zu haben. In Zeiten öffentlicher Sparmaßnahmen sind die Beiträge unserer Mitglieder und die Zuwendungen von Spender/innen überlebenswichtig. Ihnen ist dieses Heft gewidmet.
Barbara Schuy, Bundesvorsitzende
Cornelia Spohn, Bundesgeschäftsführerin
http://www.verband-binationaler.de/zeitschriftiafinformationen/iaf4-2002druck.htm
Quelle:
Lieben Gruss Petra
|
|
| nach oben |
|
 |
|
powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos
Design © trevorj
|