 |
|
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden
"Spurensuche
nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche
Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/
|
|
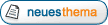 |
 |
|
Anfang
zurück
weiter
Ende
|
| Autor |
Beitrag |
Gast
|
 Erstellt: 19.12.07, 20:48 Betreff: Vermisst erst, wenn sie tot sind
drucken
weiterempfehlen Erstellt: 19.12.07, 20:48 Betreff: Vermisst erst, wenn sie tot sind
drucken
weiterempfehlen
|
 |
|
DIE ZEIT, 13.12.2007 Nr. 51
* Schlagworte:
* Politik
* Innenpolitik
* Familienpolitik
* Kinderrechte
Vermisst erst, wenn sie tot sind
Von Sabine Rückert
Auch wenn in Deutschland wohl nicht mehr Kinder getötet werden als in früheren Jahren - jeder Fall zeigt, wie die Gesellschaft Kinder in Not allein lässt
Was übrig bleibt: Zurückgelassene Rutsche hinter dem Haus in Darry, in dem kürzlich eine Mutter ihre fünf Kinder tötete
Was übrig bleibt: Zurückgelassene Rutsche hinter dem Haus in Darry, in dem kürzlich eine Mutter ihre fünf Kinder tötete
© Knut Mueller/Getty Images
Direkt vor dem Landgericht Bremen, wo Bernd K. derzeit wegen Totschlags angeklagt ist, weil er seinen zweijährigen Ziehsohn Kevin zu Tode misshandelt haben soll, hält die Straßenbahn der Linie 2. Sie fährt nach Gröpelingen, in jenen Stadtteil, wo Bernd K. mit Kevin lebte. Hier zog die Polizei am 10. Oktober 2006 die halbverweste Leiche des Kindes aus einem Kühlschrank in der Kulmerstraße Nummer 97.
Wer in der Straßenbahn nach Gröpelingen Platz nimmt, fährt von der hübschen historischen Altstadt in eines der elendsten Viertel der Hansestadt – es ist eine Reise aus der gemütlichen Mitte der Gesellschaft an ihren ungastlichen Rand, ins Zuhause der Mühseligen und Beladenen. Auf der Fahrt kann man den allmählichen Verfall an sich vorüberziehen sehen. Wenn es auf die Endstation zugeht, sitzen nur noch die Menschen mit den ärmlichen Jacken und den müden Gesichtern im Waggon.
Eine kleine, blasse Gestalt in einem heruntergekommenen Mietshaus
Gröpelingen ist einer von Tausenden sozialen Brennpunkten in Deutschland. Bremen ist zwar die Heimat vieler reicher Kaufleute, doch die 600000-Einwohner-Stadt hat mit 100000 Hartz-IV-Empfängern eine der höchsten Sozialhilfequoten der Republik, hier leben prozentual mehr Menschen von Transferleistungen des Staates als in den neuen Bundesländern. Und auf einer Negativliste der 79 Bremer Stadtteile belegt Gröpelingen Platz 2. Schlimmer steht es nur noch in den Hochhausburgen von Tenever. In Gröpelingen lebt jedes dritte Kind in Armut, beträgt der Ausländeranteil unter den Kindern fast 60 Prozent. In den Kindertagesstätten sprechen nicht nur die kleinen Migranten kein richtiges Deutsch, sondern auch die Kinder aus den zahllosen deutschen Problemfamilien. Seit die Werften in den achtziger Jahren geschlossen wurden, ist das Viertel heruntergekommen. Die Facharbeiter wanderten ab, es kamen die Verlierer. Der Wert der Immobilien ist in den vergangenen zehn Jahren um zwölf Prozent gesunken. Das Leben ist billig, man haust in schlechten Wohnungen unter seinesgleichen und ist dem Stress des sozialen Vergleichens entrückt. Auch deshalb zieht es alle, die auf dem absteigenden Ast sind, hierher.
Ein abgewirtschaftetes Mietshaus am Rande Gröpelingens war Kevins Zuhause. Zu Lebzeiten war er nur eine kleine blasse Gestalt im wachsenden Heer jener Kinder, für die sich niemand wirklich interessiert. Die Anteilnahme, die er gebraucht hätte, bekam er erst, als man ihn tot aus dem Eisschrank geborgen hatte. Dieses Schicksal teilt er mit anderen Kindern, deren Namen sich in das schlechte Gewissen der Republik eingebrannt haben: Jessica, die 2005 unbemerkt vom Rest der Welt in einem Hamburger Hochhaus verhungerte, oder Lea-Sophie, die vor wenigen Tagen in Schwerin an Unterversorgung starb. Behördenvertreter kamen und gingen und sahen die Not nicht. Erst im Todesfall werden die Kinder ein Fall für die Öffentlichkeit: Dann setzt der Betroffenheitstourismus ein, dann stehen die obligatorischen Blumen an der Haustür, werden Kerzen angesteckt, die immer gleichen Teddybären hingesetzt und die unvermeidlichen Schilder aufgebaut mit der Aufschrift: Warum?
Diese Frage stellen allerdings auch die Reporter, die angereist kommen und ihre Ü-Wagen aufbauen. Ihre Kameras und Artikel zwingen die Republik dazu, einen Blick in ihre schmutzigsten Winkel zu werfen – jene Viertel nämlich, in denen die Menschen leben, die der Kapitalismus ausgespuckt hat. Schon dafür müsste man Kevin und Jessica ein Denkmal setzen. Inzwischen decken die Medien fast täglich neue Fälle misshandelter und vernachlässigter Kinder auf: Halbtot holt man sie aus vermüllten Wohnungen, leblos findet man sie neben ihren totgefixten Müttern, aus Fenstern hat man sie geworfen, in Blumentöpfen verscharrt, oder in Tiefkühltruhen verstaut.
Wenn das Elend zu laut wird, schaut die Polizei vorbei
Liest man die Zeitungen, könnte man glauben, Kindesmisshandlung sei ein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Das ist natürlich nicht der Fall – bloß drang von den Schrecken, die sich hinter den Wohnungstüren vollzogen, bis vor wenigen Jahren wenig an die Öffentlichkeit. Totgemarterte Kleinkinder raubten höchstens ein paar Sozialarbeitern oder Gerichtsmedizinern den Schlaf. Dass das jetzt anders wird, dass sich die vernachlässigten Kinder plötzlich im Fokus der medialen Aufmerksamkeit finden, hat vielleicht auch mit dem Unbehagen zu tun, mit dem das ganze Land dabei zusieht, wie große Teile der Bevölkerung aus der sozialen Gemeinschaft rutschen.
Der Tod von Kevin dürfte mehr bewirkt haben als alle Armutsberichte zusammen. Umgekommen inmitten einer Wohlstandsgesellschaft, die mit Fragen beschäftigt ist wie: Wo gehen wir heute Abend essen? Welches Auto passt zu mir? Auf welche Schule schicke ich meine Tochter? Brauche ich nicht mal wieder ein Wellnesswochenende? Durch Kevin haben nun auch jene Kinder Gesichter bekommen, die nach wie vor in der sozialen Kälte der Elendsquartiere überleben, deren einziger Ansprechpartner der Fernseher ist; die Kinder aus Hochrisikofamilien, bei denen Gewalt, Drogen und psychische Defekte zum Alltag gehören; die Kinder aus den Vorstadthöllen, die als Analphabeten groß werden, irgendwie – wie genau, weiß niemand; die vielen Kinder ohne Zuwendung, ohne Ziel, ohne Zukunft.
Aller Medienhysterie zum Trotz werden in Deutschland aber nicht mehr Kinder getötet als in den Jahren zuvor. Die gesichtslose Statistik bilanziert gleichbleibend etwa hundert Opfer pro Jahr, die meisten werden keine vier Jahre alt. Das ist die offizielle Zahl, Gerichtsmediziner gehen von mehr Opfern aus, weil einem getöteten Säugling oft von außen gar nichts anzusehen ist und nur jeder zweite obduziert wird. Die Täter sind fast immer im Kreise der Familien zu suchen und stecken tief in prekären Verhältnissen.
Als Kevin geboren wird, ist er ein typisches Hochrisikokind aus Gröpelingen. Die Eltern sind beide Halbwaisen, beide seit ihrem 13. Lebensjahr drogensüchtig, beide haben viele Jahre im Gefängnis gesessen, lebten von staatlicher Unterstützung. Die Mutter ist bei Kevins Geburt HIV-infiziert, das Baby kommt zu früh und muss nach der Entbindung wochenlang auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Dass diese Faktoren eine lehrbuchhafte Gefahrenlage für das Kind schufen, muss allen, die mit Kevin zu tun hatten, bekannt gewesen sein.
Nach der Entlassung aus der Klinik beginnt für die Elendsfamilie eine Wanderschaft zwischen Entzugsmaßnahmen und Familienhilfe. Immer wieder werden Kevins Eltern auffällig, immer wieder wird ihnen mit befristeten Zuwendungen unter die Arme gegriffen, immer wieder scheint es kurz besser zu gehen – und dann erneut ein Polizeieinsatz: Da zeigen Bürger an, dass die taumelnde Mutter den Säugling auf offener Straße misshandelt, oder man findet die sinnlos Betrunkene mit dem hinuntergefallenen, weinenden Kind im Treppenhaus und so weiter… Die zwei Jahre, die Kevin lebt, bestehen aus einer Flickschusterei unzähliger Hilfsmaßnahmen des hilflosen Jugendamtes, pausenlos sind wechselnde Mitarbeiter irgendwelcher freier Träger mit der Familie befasst, doch echte Hilfe gibt es nicht. Wer den Bericht des Untersuchungsausschusses liest, den die Hansestadt Bremen nach Kevins Tod zusammenrief, dem drängt sich das Bild eines Schwerverletzten auf, der von unzähligen Passanten umstanden wird und der schließlich stirbt, weil keiner der Zuschauer sich seiner annimmt – es sind doch so viele andere da.
Im Prozess gegen Kevins Vater zeigt sich noch etwas anderes, das typisch ist für Haushalte, in denen plötzlich ein Kind tot ist: die totale Vereinsamung der Familie. Bei der Rekonstruktion von Kevins kurzem Leben tun sich – vor allem nach dem frühen Tod der Mutter – wochenlange Lücken auf, in denen niemand das Kind oder den Ziehvater gesehen oder vermisst hat. Das Leben eines normalen Bürgers zu recherchieren ist für die Polizei relativ simpel – es verläuft unter den Augen von tausend Zeugen: Die Familie sieht ihn beim Frühstück, Arbeitskollegen sehen ihn in der Kantine, der Nachbar sieht ihn beim Sport, der Freund beim Bier. Kevins Eltern dagegen sind in der Anonymität abhandengekommen. Sie meiden die anderen, sind mit sich und dem Kampf gegen ihre Sucht beschäftigt. Niemand fragt nach. Mit den Familien hat man gebrochen, mit den Nachbarn hat man Krach, Freunde gibt es nicht, eine Arbeitsstelle ist undenkbar. Die einzigen sozialen Kontakte bestehen zu Menschen, die von Berufs wegen mit Kevins Eltern zu tun haben, deshalb können vor Gericht nur Amtspersonen und Ärzte tatsächlich Angaben zu Kevin und seinem Vater machen.
In der Klientel, mit der Jugendämter täglich zu tun haben, sind solche Familien nicht selten: Menschen, die im totalen Rückzug leben und sich im Abseits wie Ertrinkende aneinanderklammern. In eine derartige Isolation vorzudringen ist mühevoll für die Sozialarbeiter. Oft haben die Eltern aus ihrer eigenen Kindheit massive soziale Verkrüppelungen davongetragen: Die Wege, tragbare Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, sind ihnen verschlossen. Die kleinste Frustration führt zu Gewalt oder Partnerwechsel. Zusätzlicher Stress entsteht durch Arbeitslosigkeit, schlechte Bildung, menschenfeindliche Behausungen, Alkohol, Lärm, Streit und den ewigen Mangel, der das Leben vergiftet. Viele Menschen in Deutschland leben unbeachtet so – mit ihren Kindern. Nur manchmal, wenn das Elend zu laut wird, schaut die Polizei vorbei.
Der um sich greifenden Not gegenüber stehen Jugendämter mit schrumpfenden Haushalten. In Bremen wurde zum Beispiel in den vergangenen sechs Jahren ein Drittel des pädagogischen Personals in der Abteilung »Junge Menschen« abgebaut. Diese Tendenz, die Jugendarbeit kaputtzusparen, kennt man auch in anderen Städten und Bundesländern. Man darf sich fragen, wer noch mit Engagement im Jugendamt arbeitet, wenn von der Jugendhilfe nur das Sparen bleibt und sich nun vor allem jene Mitarbeiter profilieren, die am wenigsten Geld ausgeben.
Im Bremer Herrmann-Hildebrand-Haus, einem Heim für in Obhut genommene Kinder, fiel 2005 auf, dass das Jugendamt plötzlich nicht mehr wie sonst 100 Kinder im Jahr unterbrachte, sondern nur 44, davon 40 in der ersten Jahreshälfte. In der zweiten Hälfte reichte das Budget nur noch für 4 Kinder. Eines davon war Kevin. Jetzt, nach dem schrecklichen Tod des Jungen, sind es übers Jahr wieder 100. Den Sparzwang haben nicht einzelne Bedienstete zu verantworten, sondern er ist politisch gewollt. Der Druck kommt von oben aus dem Senat, wo der Verteilungskampf um die Ressourcen tobt, und setzt sich durch die Hierarchie nach unten fort bis zum ausführenden Organ. Das ist das Fadenscheinige an der öffentlichen Debatte: Kinderschutz will jeder, bezahlen will ihn keiner.
Erschwert wird die Arbeit des Jugendamtes auch durch seinen ambivalenten Auftrag: Es soll Helfer und Kontrolleur in einem sein. Das Letztere lehnen viele der Sozialpädagogen ab. Sie sehen ihre Aufgabe nicht in der Bespitzelung des Prekariats, sondern setzen auf Kooperation und Verständnis. Einige fürchten, das mühsam erkämpfte Vertrauen ihrer misstrauischen Klientel wieder zu verlieren, wenn sie mit Drohungen daherkommen, beim Hausbesuch einen Blick ins verschlossene Hinterzimmer werfen oder sämtliche Kinder unbekleidet sehen wollen. Andere pflegen die grundsätzliche Staatsferne: Sie haben Probleme damit, als Verkörperung einer Behörde aufzutreten und Sanktionen gegen Menschen zu verhängen, die es ohnehin schlecht haben. Ein Kind mitzunehmen, während die Mutter sich aus dem Fenster stürzen will, ist keine beneidenswerte Aufgabe. In vielen Fällen tödlich verlaufender Kindesmisshandlung wurde die Familie deshalb zuvor unterstützt, wo es ging, mit dem Ziel, das Kind unter allen Umständen bei seinen Eltern zu belassen.
Viele Ärzte verkennen oder verschweigen Misshandlungsspuren
Das Kind nicht ins Heim zu geben, sondern die »Ressourcen der Eltern« zu nutzen, lautet der schwammige Auftrag der Jugendämter seit den neunziger Jahren, und hier kommt die liberale Ideologie dem Sparzwang unheilvoll entgegen. Das Sozialarbeiter-Credo, für ein Kind seien die eigenen Eltern immer das Beste, wird von Schicksalen wie dem der siebenjährigen Jessica aus Hamburg-Jenfeld eindrucksvoll widerlegt: Weil ihre eigene Mutter es so wollte, verhungerte sie in einem finsteren Zimmer, während Jessicas Bruder, der, der Mutter entzogen, bei Adoptiveltern aufwuchs, heute das Gymnasium besucht.
Eine Problemfamilie staatlich zu begleiten ist ein heikler und hoch komplizierter Prozess. Oft ist die Lage nicht leicht zu durchschauen. Die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder ist im Artikel 6 des Grundgesetzes festgeschrieben. Auch benachteiligte Familien bestehen aus Bürgern dieses freien und demokratischen Landes. Sie haben Rechte, die man ihnen nur entziehen darf, wenn sie ihren Kindern nachweislich ernsten Schaden zufügen. Mag der öffentliche Schrei nach mehr Kontrolle durch die Jugendämter nach den jüngsten Todesfällen auch laut und berechtigt sein – kein Mensch kann sich ernstlich Jugendarbeit als Überwachungsmaßnahme nach totalitärem Vorbild wünschen: einen Staat, der schon im Verdachtsfall in die Wohnung stürmt und die Kinder ohne näheres Hinsehen herausreißt, der seine Bürger letztlich verachtet und an ihnen Exempel statuiert. Blindwütige Mitarbeiterinnen, die im Machtrausch die Unterprivilegierten das Fürchten lehren, kommen nämlich auch jetzt schon in deutschen Jugendämtern vor – mögen ihre Untaten aus Gründen der Political Correctness derzeit auch nicht das Lieblingsthema der Medien sein. Und sie richten in den Familien nicht weniger Schaden an als die Feiglinge und Zauderer, die sich auch beim zehnten Bluterguss noch zu keiner Konsequenz durchringen können.
Nur wenige Fälle sind so klar wie der des kleinen Kevin. Auch für die Ärzte, jene zweite Personengruppe, die in Misshandlungs- und Vernachlässigungsfällen Entscheidungen zu treffen hat. Manchmal sind die Verletzungen nicht klar als Trauma zu deuten, und wenn doch, dann steht der Verursacher immer noch nicht fest: Ist es der Vater? Die Mutter? Der Onkel? Der Babysitter? Kinderärzte fürchten, durch einen bloßen Verdacht – der sich dann auch noch als falsch herausstellt – Existenzen zu zerstören. Und stehen sie als Zeugen vor Gericht, müssen sie ihre Schlussfolgerungen gut begründen können. Davor schrecken viele zurück und berufen sich lieber auf die ärztliche Schweigepflicht.
Die Gerichtsmediziner beklagen seit Langem, dass Fehldiagnosen, Behördenscheu, lückenhafte Rechtskenntnisse und mangelhafte sozialmedizinische Verantwortung von Ärzten zu einer hohen Dunkelziffer bei Kindesmisshandlungen beitragen. Eine Reihenuntersuchung im Rechtsmedizinischen Institut Münster zeigte, dass bei fast hundert Prozent der dort obduzierten tödlich verlaufenden Kindesmisshandlungen mindestens ein Arzt, meistens mehrere Ärzte im Vorfeld mit Verletzungen des Kindes konfrontiert waren und entweder die Misshandlungsspuren nicht erkannt oder verschwiegen hatten. Im Fall Kevin hegten die Ärzte zwar keinen Zweifel an einer schweren Misshandlung – gerettet haben sie ihn dennoch nicht. Am 27. September 2004 wurde der zehn Monate alte Säugling vom zuständigen Kinderarzt mit zwei gebrochenen Unterschenkeln und dem Hinweis »Battered-Child-Syndrom« in eine Kinderklinik überwiesen. Dort fanden die Röntgenärzte obendrein mehrere Rippenbrüche, Unterarmfrakturen und Schädelbrüche verschiedenen Alters, die das Kind bereits vor Wochen erlitten hatte.
Vor Gericht erinnert sich einer der Ärzte, der Fall sei in der »Mittagsbesprechung« vorgestellt worden und alle Anwesenden seien entsetzt gewesen von der Zerschlagenheit des kleinen Kevin. Dessen Eltern bestritten allerdings, dem Kind etwas angetan zu haben, und weil sich die Mutter in den 16 Tagen, die Kevin im Krankenhaus kuriert wurde, »zugewandt und liebevoll« verhielt, und weil der zuständige Mensch im Jugendamt keinen Antrag auf Fremdunterbringung stellen mochte, verzichtete man auf weitere Schritte.
Man behielt das Kind durch Nachuntersuchungen noch eine Weile im Auge, doch als der Vater irgendwann aggressiv wurde und die Zusammenarbeit abrupt aufkündigte, ließ man die Familie ziehen, obgleich das Kind unterernährt und stark zurückgeblieben war, die drogensüchtige Mutter einen »weggetretenen« Eindruck machte und der behandelnde Klinikarzt das Kind in einem Gespräch mit dem niedergelassenen Kinderarzt als »hochgefährdet« eingestuft hatte.
Auch in Zukunft wird es von Einzelnen abhängen, ob Kinder gerettet werden
Fragt man den zuständigen Chefarzt der Kinderklinik, der über Kevin informiert war, warum damals niemand bei der Staatsanwaltschaft angerufen habe, zieht er sich auf fast pastorale Weise aus der Verantwortung: »Wir sind keine Polizisten, wir sind Kinderärzte und glauben an das Gute im Menschen«, sagte er der ZEIT. Die Eltern hätten sich der Klinik »anvertraut«. Die Mutter – obwohl drogensüchtig – habe auf der Station einen guten Eindruck hinterlassen, und weil ein Kind »nirgendwo besser aufgehoben ist als bei den eigenen Eltern«, habe man ihr das Kind überantwortet. Das Jugendamt war informiert, dessen Aufgabe sei es gewesen zu handeln. Die Sichtweise dieses Professors ist keine Ausnahmehaltung, sie ist unter den Ärzten die Regel.
Nach Kevins Tod hat man in Bremen nun einen Kindernotruf installiert, die Informationspolitik des Jugendamtes professioneller gestaltet, wieder ein paar Leute eingestellt und die zehn freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen in den ersten Lebensjahren aller Kinder, die sogenannten U-Untersuchungen, zur elterlichen Pflicht erhoben. Wer die Termine schwänzt, bekommt Besuch vom Jugendamt. Das sind alles überfällige Verbesserungen: Bloß nützen alle Informationsströme und Patrouillen bei sozial randständigen Familien nichts, wenn letztlich niemand es wagt, sich anzulegen. Die Verpflichtung, eine lebensrettende Entscheidung zu treffen, bleibt bestehen. Auch in Zukunft wird es von der Klugheit, dem Augenmaß und der Zivilcourage Einzelner abhängen, ob Kinder gerettet werden oder nicht.
Wenn Schicksale wie das des kleinen Kevin vermieden werden sollen, wird es nicht reichen, nach Kontrolle und Polizei zu rufen. Die Politik wird sich schon aufraffen müssen, die Lebensbedingungen der Schwachen zu verbessern und in die Kinderfürsorge der vergessenen Viertel zu investieren. Arbeit für alle, das gibt es nicht mehr, doch auch wer keine hat, muss ins Schwimmbad und ins Theater gehen können, muss die Möglichkeit haben, mit seinen Kindern ein humanes Leben zu führen. Und diese Kinder müssen Bildung haben – und sei es durch Ganztagsschulen, die sie dem Einflussbereich ihrer Eltern entziehen. Damit wenigstens die Kleinen eine Chance bekommen, sich selbst aus den erbärmlichen Verhältnissen zu befreien.
Ein Land, das in seine benachteiligten Kinder investiert, spart später bei der Kriminalitätsbekämpfung, bei den Kosten für Gefängnisse und Psychiatrien, bei den Sozialeinrichtungen der Nachsorge. Aus schwachen Kindern werden schwache Erwachsene, die wieder schwache Kinder haben. Bund, Länder und Kommunen werden sich also neu überlegen müssen, in welche Projekte staatliche Ressourcen fließen sollen: in Fußballstadien, Autobahnen – oder in die Zukunft der Kevins dieses Landes.
Diesen Artikel auf vielen Seiten lesen
© DIE ZEIT, 13.12.2007 Nr. 51
zum Thema
* Schlagworte:
* Politik
* Innenpolitik
* Familienpolitik
* Kinderrechte
* Grundgesetz
ZEIT online 51/2007
o
Wie kann man helfen?
-
Die Parteien sind sich uneins: Sollen Kinder über die Verfassung geschützt werden? »
ZEIT online 51/2007
o
Zeichen setzen
-
Kinderrechte im Grundgesetz sind nur ein Symbol - aber eines, das Kraft entwickeln könnte. »
ZEIT online 51/2007
o
Handeln statt formulieren
-
Das Grundgesetz fordert längst den umfassenden Kinderschutz. Man sollte es in Ruhe lassen »
ZEIT online /2007
o
Kinderrecht und Kinderleid
-
Ein Schwerpunkt zu den Themen Kinderrecht, Gewalt an Kindern, Armut und Bildung »
http://www.zeit.de/2007/51/Bremen?page=all
|
|
| nach oben |
|
 |
|
powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos
Design © trevorj
|
